Inhaltsverzeichnis
- 1 Bild: Kniegelenk mit Patella, Sagittalschnitt
- 2 Patella
- 3 Pathologie der Patella
- 3.1 Dysplasien der Patella
- 3.2 Patella bipartita
- 3.3 Tanzende Patella
- 3.4 Osteopathia patellae
- 3.5 Aplasia patellae
- 3.6 Hypoplasia patellae
- 3.7 Patellafraktur
- 3.8 Patellaluxation
- 3.9 Chondropathia patellae / Chondromalacia patellae / PFPS Patello-Femoral Pain Syndrome
- 3.10 Retropatellarthrose
- 3.11 Patellaspitzensyndrom (Jumper’s knee, Springerknie)
- 3.12 Anriss oder Abriss des Lig. patellae
- 4 Gelenke
Bild: Kniegelenk mit Patella, Sagittalschnitt
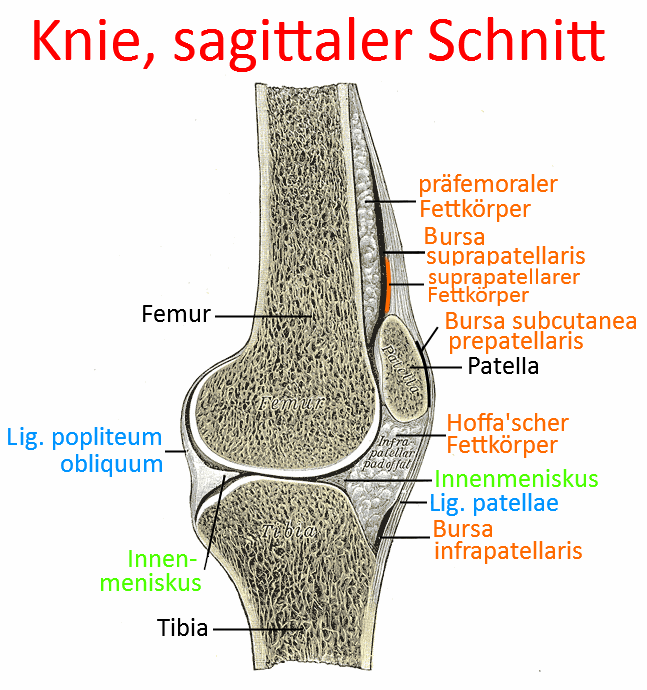
Patella
Kniescheibe, das größte Ganglion und Sesambein oder Hypomochlion des menschlichen Körpers. Die Kniescheibe ist eine dem Femur vorgelagerte Knochenscheibe, sie gleitet bei Streckung und Beugung des Kniegelenks über das femoropatellare Gleitlager (Articulatio femoropatellaris) des distalen Femur. Am kaudalen Ende der Patella (kaudaler Patellapol) setzt das Ligamentum patellae an, am kranialen Ende (kranialer Patellapol) setzen etwa 50% der Sehnenfasern des Quadrizeps an, so dass dessen Sehnenkraft kraftschlüssig auf die Tuberositas tibiae, die Knochenaufrauhung des proximalen ventralen Schienbeins, übertragen werden und eine Streckung im Kniegelenk bewirkt werden kann. Die Patella bewirkt als Hypomochlion dabei ein vergrößertes Drehmoment.
Die Anteile des Quadrizeps setzen entsprechend ihrer Lage am kaudalen Patellapol an: Vastus medialis eher medial, Vastus intermedius mittig, und Rectus femoris und Vastus lateralis eher mittig bis lateral, Vastus medialis und Vastus lateralis bilden also eine Art Zügelsystem der Patella. Daraus kann bei ausgeprägt ungleichem Zug eine Verschiebung der Patella (typischerweise ist eher der Zug des Vastus lateralis gegenüber dem Vastus medialis zu hoch als umgekehrt, also nach lateral) resultieren, zudem ein Rotationsmoment der Patella (kaudal nach lateral) und ein Tilt (lateral nach dorsal), was eine Gefahr insbesondere für den lateralen Teil des retropatellaren Knorpels darstellt. Über eine Chondropathia patellae (PFPS) kann es später zu einer Retropatellararthrose kommen. Da der retropatellare Knorpel relativ zellarm ist und zum großen Teil aus Bindegewebe besteht, ist eine Selbstheilung nur sehr eingeschränkt möglich. Außerdem treten unter diesen Bedingungen leichter schmerzhafte Patellaluxationen auf, die meist das mediale Retinaculum zerreißen, wodurch es umso schneller zu erneuten Patellaluxationen kommt.
Die Patella weist einen durchschnittlichen minimalen Hebelarm von 36 mm auf, ohne Patella läge er bei etwa 25 mm. Das alleine ist ein schwerwiegender Faktor, der gegen Patellektomien spricht, so diese nicht zwingend erforderlich sind, zumal danach die Sehne des Quadrizeps zu lang erscheint, was eine ungünstige Verschiebung im Sinne der Kraft-Längen-Funktion bedeutet. Dieser Effekt multipliziert sich auf die Verschlechterung des Hebelarms, die alleine Faktor 1,44 bedeutet. Der häufigste Störfaktor in femoropatellaren Gelenk ist eine unpassende Geometrie der Trochlea femoris. Der Sulcuswinkel der Trochlea ist der Einzelfaktor, der am besten mit der Symptomatik bei femoropatellaren Beschwerden korreliert. Physiologisch ist die mediale Hälfte der Patellarrückseite weniger ausgeprägt als die laterale Hälfte, was der biomechanisch bedingten Kraftverteilung von 40 zu 60 Rechnung trägt. Nahe der Streckung des Kniegelenks nimmt der retropatellare Anpressdruck ab, bei fast gestreckt im Kniegelenk kann gerade zu davon gesprochen werden, dass keine Artikulation mehr stattfindet. die Kniescheibe ist dann sehr mobil und ihre Stabilität hängt sehr von den mit ihr verbundenen Weichteilen ab. Bereits bei 20 Grad Beugung kann wieder von einer regelgerechten Artikulation und einer Stabilität ausgegangen werden. Aufgrund der veränderlichen Krümmung der Femurkondylen an die Patella mit dem Femur nicht bei jedem Beugewinkel des Kniegelenks ein kongruentes Gelenk bilden. Während bei 20° Beugung vor allem der distale Teil der Patella Kontakt zum Femur hat, verschiebt sich die Kontaktfläche mit zunehmender Beugung in Richtung kranial. Bis zu 90° Beugung hatte dann jeder Teil des retropatellaren Knorpels mit Ausnahme der Odd-Facette Kontakt mit der Trochlea femoris. Ab 90° Beugung hat auch die Quadrizepssehnedirekt Kontakt mit der Trochlea femoris. Die Odd-Facette Gerät in Kontakt mit der medialen Femurkondyle ab etwa 130 Grad Beugung. Die Kontaktfläche der Patella mit dem Femur nimmt von 20 bis 90° zu, andererseits nimmt auch der retropatellare Anpressdruck zu.
Patellapol
die (in vertikaler Richtung gesehen) beiden „Pole“ der Patella (Kniescheibe), der kaudale Patellapol und der kraniale Patellapol. Am kranialen Patellapol, also am kranialen, setzt der Quadrizeps sehnig an, am unteren das Ligamentum patellae, welches zuweilen fälschlich als „Patella(r)sehne“ bezeichnet wird. Da das Ligamentum patellae in gespanntem Zustand, also immer, wenn ein über die Ruhespannung hinausgehendes Mindestmaß an Spannung des Quadrizeps vorherrscht, straff und inflexibel ist, befindet sich der kaudale Patellapol in konstantem Abstand zur Tuberositas tibiae, dem Ansatzbereich des Ligamentum patellae am Schienbein.
kranialer Patellapol
am kranialen Patellapol setzen rund 50% der Fasern der Ansatzsehne des Quadrizeps an, um dessen Kontraktionskraft drehmomentverstärend über dieses Hypomochlion auf die Tuberositas tibiae zu übertragen. Die restlichen Fasern der Ansatzsehne überziehen die Patella in Richtung Tuberositas tibiae oder verlaufen medial oder lateral der Patella als Retinaculum patellae mediale bzw. Retinaculum patellae laterale.
kaudaler Patellapol
am kaudalen Patellapol setzt das Ligamentum patellae an, um die Bewegung der Patella auf die Tuberositas tibiae zu übertragen. Das Ligamentum patellae besitzt keine nennenswerte Elastizität und garantiert damit in gespanntem Zustand einen festen Abstand zwischen kaudalem Patellapol und Tuberositas tibiae, womit bei konzentrischer Kontraktion des Quadrizeps dessen Kontraktionskraft eine Bewegung der Patella und konsekutiv der Tuberositas tibiae bewirkt.
retropatellarer Knorpel
der retropatellare Knorpel, also die Knorpelschicht, die im femoropatellaren Gleitlager über ihren Gelenkpartner, den Femur bzw. dessen Knorpel gleitet, ist nicht ohne Grund die dickste des menschlichen Körpers. Hier liegen je nach Winkel des Kniegelenks und Kontraktionskraft des Quadrizeps schnell hohe Drücke vor. Schäden am Knorpel sind als Chondropathia patellae (PFPS) oder, fortgeschrittener als Retropatellararthrose bekannt.
Pathologie der Patella
Dysplasien der Patella
Siehe Patelladysplasien
Patella bipartita
Die Patella liegt hier in zwei meist asymmetrischenTeilen vor, der lateroproximale Knochenkern ist nicht mit dem anderen verschmolzen. In Gegensatz zu einer Patellafraktur sind bei der Patella bipartita die zueinander weisenden Knochenflächen rund und nicht richtig kongruent statt wie bei der Fraktur scharfkantig und kongruent.
Tanzende Patella
Ein retropatellarer Erguss läßt die Patella auf der Ergussmasse „aufschwimmen“
Osteopathia patellae
siehe Morbus Sinding-Larsen Johannsen
Aplasia patellae
Der Fall einer gänzlich fehlenden Patella
Hypoplasia patellae
Der Fall einer zu kleinen Patella
Patellafraktur
Fraktur: Patellafraktur
Patellaluxation
Der Fall einer nach lateral atraumatisch luxierten Patella oder traumatisch luxierten Patella
Chondropathia patellae / Chondromalacia patellae / PFPS Patello-Femoral Pain Syndrome
Das Retropatellare Knorpelleiden
Retropatellarthrose
Arthrose des retropatellaren Knorpels, siehe Retropatellarthrose
Patellaspitzensyndrom (Jumper’s knee, Springerknie)
Der Fall einer Störung der Insertion des Lig. patellae am kaudalen Patellapol:Jumper’s knee
Anriss oder Abriss des Lig. patellae
meist traumatischer Riss am/vom kaudalen Patellapol
